Rolf Bick
Die Zukunft der Gestaltpädagogik –
Erinnerungen und Perspektiven
„Gestaltpädagogik - was ist das denn?“ Sie kennen diese Frage von Kollegen und Bekannten. Auf diese Frage möchte ich eine Antwort geben.
Zunächst eine sehr allgemeine Antwort: Weil hier Menschen mit Menschen umgehen, ist Gestaltpädagogik ein soziales System. „Ein soziales System ist ein Zusammenhang sinnhaft aufeinander bezogener Handlungen, der von seiner Umwelt abgegrenzt werden kann“, so Niclas Luhmann (1).
Etwas konkreter: Gestaltpädagogik ist ein Subsystem im allgemeinen pädagogischen Sytem und muss von diesem abgrenzbar sein. Sie braucht etwas nur für sie Spezifisches, was sie von anderen pädagogischen Ansätzen unterscheidet. Denn Abgrenzung setzt voraus, dass wir so und die Anderen - wenigstens an einem wichtigen Punkt - anders sind. Es muss klar sein, dass dieses Gestaltpädagogik ist und jenes nicht. Ob sie eine Zukunft hat, hängt davon ab, ob sie ein solches eigenes Spezifikum, eine eigene Identität entwickelt und durchhält.
Ich werde zunächst einiges Grundsätzliche referieren, danach das Spezifische der Gestaltpädagogik und ihre Schnittmengen mit anderen Ansätzen. Zum Schluss werde ich fragen, ob diese Gestaltpädagogik wohl eine Zukunft hat. Dabei habe ich nur wenig Neues zu sagen. Manches habe ich bereits vor einigen Jahren gesagt und veröffentlicht. Ich fasse dies noch einmal zusammen und führe es ein Stück weiter.
1. Das Grundsätzliche
1.1 Ganzheit und soziale Systeme
Der für die Gestaltpädagogik zentrale Begriff der Ganzheit führt uns zurück zur alten Gestaltpsychologie im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts. Vorher war die Psychologie ein Teilgebiet der Philosophie, eine Geisteswissenschaft wie die Pädagogik auch. Nun aber will sie eine exakte Naturwissenschaft sein. So untersucht man, was man exakt und experimentell messen und beobachten kann, nicht das verdeckte, sondern das beobachtbare und nachprüfbare Verhalten, nicht das Ganze, sondern seine einzelnen Elemente. Dagegen wenden sich nun die Gestaltpsychlogen: Wenn wir die Wirklichkeit in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen, können wir sie nicht mehr erfassen. Denn sie besteht ja gerade darin, dass alle die Einzelaspekte ihren ganz bestimmten Platz haben in einem höchst komplexen Zuordnungssystem. Unmittelbar einsichtig ist dies am Beispiel einer Melodie: Zerlegt man sie, dann zerstört man sie. Sie besteht nur, solange die einzelnen Noten einander zugeordnet sind, jeweils ihren bestimmten Ort im Ganzen haben. So untersuchen die Gestaltpsychologen auf experimentelle Weise die Gesetze und Strukturen in Ganzheiten. Das Ganze aber sei mehr als die Summe seiner Teile. Es habe nicht nur eine summenhafte, es habe auch eine andere, eigene Qualität.
Sechzig Jahre später wird der Soziologe Niclas Luhmann nicht mehr wie die alten Gestaltpsychologen von der ‚inneren Natur des Ganzen‘ sprechen. Er drückt das, was sie damit gemeint haben, in systemtheoretischen Begriffen aus: „Ein soziales System ist ein Zusammenhang sinnhaft aufeinander bezogener Handlungen.“ Gemeint ist auch hier: Wir leben nicht isoliert, sondern zwischen den anderen, eingebunden und vernetzt in unterschiedliche Zusammenhänge. Unsere Herkunftsfamilie war ein soziales System, Schulklasse und Schule sind Systeme usw. Auch der Einzelne ist ein Zusammenhang gegenseitiger Beeinflussungen und Handlungen und damit ein System.
Die alte Gestaltpsychologie ist Geschichte. Das Denken in Systemen ist heute wissenschaftliches Allgemeingut. In dieses moderne Denken zeichnen wir auch unsere Gestaltpädagogik ein.
1.2 Ganzheit als Illusion oder Evidenzerfahrung
Das Wort ‚Ganzheit‘ aber lebt weiter als ein oft ideologisch überfrachtetes Modewort. In der Psychoszene arbeitet man heute selbstverständlich ‚ganzheitlich', was immer das auch heißen mag. Auch bei Pädagogen, Bausparkassen und anderen ist ‚Ganzheit‘ das Thema. Schon der Gestaltpsychologe Wolfgang Metzger beklagte: „Ein ganz schlimmes Missverständnis ist die Meinung, die Ausdrücke ‚Ganzes, Ganzheit‘. . . seien eine Art von Zauberworten. Man nennt das Zauberwort und alle Rätsel sind gelöst.“ Er spricht von „genügsamen Zeitgenossen, die durch den bloßen Hinweis auf die Ganzheit irgend etwas erklärt zu haben glauben“ (2). Denn solch pauschales Reden von Ganzheit wird immer dann zu einer leeren Formel, wenn man die Vielzahl und Komplexität seiner Teile nicht mehr wahrnimmt.
In den 80er Jahren forderte der Physiker Fritjof Capra in seinem Buch ‚Wendezeit‘ den großen Umdenkungsprozess weg vom atomistischen und hin zum ganzheitlichen Erfassen der Wirklichkeit. Aus dem Ganzheitsansatz sollen Rezepte für alle Lebensbereiche erwachsen. Das alles ist ebenso einleuchtend wie schwierig, denn es gibt nicht die Apotheke, in der man diese schönen Rezepte auch einlösen könnte. Und es wird sie auch nicht geben! Denn schon zur Ganzheit eines einzigen Menschen gehören Gefühl, Verstand und Körper, eingebettet in das System seiner persönlichen Beziehungen; hierzu gehören seine sozialen, gesellschaftlichen, zeitgeschichtlichen und ökologischen Kontexte. Hierzu gehört auch all das Vergangene, das Bewusstgebliebene, das Vergessene und Verdrängte. Das Ganze aber ist nicht nur die Summe aller seiner vergangenen und gegenwärtigen Beeinflussungen und Handlungen. Es kommt nicht nur auf deren Zahl an, sondern auf deren Platz im individuellen Kontext. Sie sind die Noten in einer ganz individuellen Melodie. Und sie ruhen in diesem Fundus nicht isoliert nebeneinander, sie beeinflussen sich gegenseitig, sind miteinander verwoben durch eine unbekannte Vielzahl verborgener zirkulärer Prozesse.
Der Begriff der Ganzheit definiert, dass alles in ihm enthalten ist und nichts fehlt. Es ist der Begriff für ein System mit der höchsten erreichbaren Komplexität. Solche Ganzheit aber ist nie wirklich zu durchschauen oder restlos zu ordnen. Wer sich darum bemüht, zeichnet eine eckige Figur in einen Kreis ein. Den ganzen Kreis füllt er nie aus. Weil das Ganze viel zu komplex ist, gibt es - genau genommen - keine ganzheitliche Beratung, keine ganzheitliche Pädagogik, keine ganzheitliche Politik oder was auch immer. Darum ist die Forderung und das Versprechen, ganzheitlich zu handeln, eine grandiose Überforderung und eine Illusion. „Glaub unsereinem, das Ganze ist nur für einen Gott gemacht“, sagt Mephisto. Und Paulus schreibt: „Unser Wissen ist Stückwerk“ (1.Kor.13). Das gilt auch für unser pädagogisches Wissen.
Aber es gibt durchaus Evidenzerfahrungen von Ganzheit. Evidenzerfahrungen (lateinisch: evideri = herausscheinen, herausragen) sind Erfahrungen, die offenkundig sind, die unmittelbar einleuchten, darum nicht mehr zu negieren sind und nicht mehr bewiesen werden müssen. Dies zeigt etwa das ökologische System: Auch wenn wir die Vielzahl und die jeweilige Zuordnung der gegenseitigen Beeinflussungen nicht restlos auflisten können, so erfahren wir doch, dass konkrete Eingriffe weitreichende und oft unvorhersehbare Folgen haben können.
Ähnlich in unseren Gruppen: Wir intervenieren bei einem Schüler, und es kann sein, dass die ganze Gruppe in Aufruhr gerät, weil wir es hier mit einem ganzheitlichen System zu tun haben, nach Luhmann mit einem „Zusammenhang sinnhaft aufeinander bezogener Handlungen“. Auch in der therapeutischen Begleitung bearbeiten wir konkrete Szenen. Dem Klienten eröffnet dies neue Lebensmöglichkeiten, die ihm bisher verschlossen waren, obwohl vieles, was damals auch noch eine Rolle gespielt haben mag, nicht sichtbar geworden ist.
Aufgrund solcher Evidenzerfahrungen halten wir am Ganzheitsansatz fest, wenn auch in der gebotenen Nüchternheit. Wir ‚wissen‘ um Ganzheit, das heißt: Wir gehen davon aus, dass es solche ganzheitlichen Zusammenhänge gibt. Wir streben für uns selbst und unsere Schüler nach mehr ganzheitlichem Leben. Aber wir können solche Ganzheit nicht wirklich erfassen oder durchschauen.
1.3 Die Dynamik sozialer Systeme
Soziale Systeme haben eine innere Dynamik, die bei den Gestaltpsychologen, bei Niclas Luhmann und in der Kybernetik jeweils unterschiedlich beschrieben wird:
1.3.1 Die alten Gestaltpsychologen beschrieben sie mit dem Wechselschema von Figur und Grund und als Tendenz, ‚offene‘ Gestalten zu schließen
Dieses Wechselschema
haben sie unter anderem am Rubin-Pokal deutlich gemacht
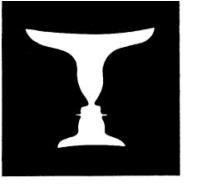
Dem Beschauer
zeigt sich ein Pokal. Aber bei längerem Anschauen kippt das Bild um:
War bisher ein Pokal zu sehen, so treten jetzt zwei Gesichter in den
Vordergrund, der Pokal aber wird zum Hintergrund, er verschwindet
– bis das Bild wieder umkippt. Man sieht nie beides gleichzeitig.
Die alte Gestaltpsychologie beschreibt hiermit das für sie zentrale
Figur-Grund-Schema: Eine Figur hebt sich ab vom flächigen Hintergrund,
zieht Wahrnehmung auf sich und tritt schließlich wieder zurück, wird
Teil des Grundes, aus dem sich eine andere Figur heraushebt.
Mit unserem Gestalt-System-Schema übernehmen und differenzieren wir dieses alte Figur-Grund-Schema. Wir sprechen nun vom Lebensgrund, aus dem sich im Lebensprozess Gestalten herauspräzisieren und wieder zurücktreten. Dieser Lebensgrund ist nun nicht mehr einfarbig und flächig, wie die Modellbilder der Gestaltpsychologie. Er ist überaus vielfarbig und vieldimensional, umfasst die ganze Gegenwart und die ganze Lebensgeschichte, ein System mit der höchstmöglichen Komplexität. Aus diesem System präzisieren sich im Laufe des Lebensprozesses immer wieder Figuren - wir nennen sie ‚Gestalten‘ heraus, bis sie schlielich wieder zurücktreten und sich mit den anderen Teilen des Systems egalisieren und dadurch anderen ‚Gestalten‘ Platz machen. Nicht das alte flächige Figur-Grund-Schema, wohl aber das differenzierende Gestalt-System-Schema ist für uns das konstitutive Modell, aus dem heraus sich auch Gestaltpädagogik entwirft.
Die Tendenz ‚offene‘ Gestalten zu schließen, den ‚Zeigarnikeffekt‘ , Angefangenes zu vollenden, haben die Gestaltpsychologen in vielen Experimenten nachgewiesen. Denn Unerledites bleibt im Gedächtnis, weil ein Bedürfnis nach Erledigung besteht, das zur bewussten Weiterbeschäftigung mit dem Begonnenen führt. Auch dies ist eine allgemeine Lebenserfahrung und ein Motor für die Dynamik sozialer Systeme: Man möchte das eine fertig machen, um es ‚ablegen‘ zu können und Neues zu beginnen.
1.3.2 Niclas Luhmann beschreibt diese Dynamik als Prozess von Sinnsuche und Sinnfindung, denn „ein soziales System ist ein Zusammenhang sinnhaft aufeinander bezogener Handlungen“. Die Frage nach dem Sinn wird hier nicht im Rahmen philosophischer Reflexionen gestellt, die dann als moralische Forderungen von außen herangetragen werden. Sie ist nicht nur eine ‚Zusatzfrage‘ für besonders nachdenkliche Leute. Sie stellt sich ganz elementar. Denn soziale Systeme können nur überleben, wenn das, was man miteinander tut, in irgendeiner Weise ‚sinnhaft‘ ist, das heißt: wenn es zu etwas dient. So findet man sich zusammen, um zu ... Man macht dies und jenes, damit ... Man möchte durch sein Handeln oder Unterlassen irgend etwas erreichen (3).
Der allgemeinste Sinn sozialer Systeme ist, sich selbst zu erhalten. Man hält zusammen, um nicht auseinander gehen zu müssen. Man lehnt Neues ab, um Veränderungen auszuweichen. Der Kranke hält am Leben fest, um nicht zu sterben. Der Trotzige beharrt auf seinem Trotz, um nicht nachgeben zu müssen. Es gibt offenen, ausformulierten und dadurch rational abrufbaren Sinn. Und es gibt verdeckten, nicht bewussten Sinn. Sinngebung kann sich auch in die Absurdität verlieren, in den Widersinn. So ist die Frage nach dem Sinn die Schlüsselfrage der Gestaltpädagogik. Wozu tut die Gruppe, wozu tut der Einzelne das? Was soll damit erreicht werden?
1.3.3 Im kybernetischen Konzept schließlich entsteht Dynamik durch die bereits genannten zirkulären Prozesse, die aus einem beziehungslosen Nebeneinander erst ein System machen, jene wechselseitigen bestätigenden und infrage stellenden Interaktionen, die sich in einem fortschreitenden Prozess gegenseitig beeinflussen und dieses System aus sich heraus verändern.
Das Wechselschema von Gestalt und System, die Tendenz, offene Gestalten zu schließen, Sinnsuche und Sinnfindung sowie zirkuläre Prozesse halten soziale Systeme - auch unsere Schülergruppen - von ‚innen‘, d.h. aus sich selbst heraus, in Bewegung. Und es gibt Anstöße von außen.
1.4 Die Steuerung komplexer sozialer Systeme
Wir haben die Komplexität des Lebens zunächst an der unüberschaubaren Vielzahl von Beeinflussungen deutlich gemacht, die schon auf einen einzelnen Menschen treffen. Gruppen sind noch viel komplexer, denn hier summieren und verbinden sich viele einzelne Leben mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Mit solchen Gruppen arbeiten wir, weil wir einen ‚Sinn‘ darin sehen, um mit Luhmann zu sprechen. Wir wollen steuern, beeinflussen und verändern. Wir tun dies, damit wir etwas erreichen.
Bei diesem Steuerungsauftrag stoßen wir an Grenzen, die es in unterschiedlichem Maße auch bei anderen sozialen Systemen gibt. Das volkswirtschaftliche Gesamtsystem zum Beispiel ist so komplex, dass es auch der Wissenschaft bisher noch nicht gelingt, dies alles durchschaubar und dadurch steuerbar zu machen. Genau das ist die unauflösliche Schwierigkeit jeder Politik, die Zukunft planvoll gestalten will. Erreichen Systeme eine hohe Komplexität, so ist eine gezielte Steuerung und Veränderung nur noch bedingt oder überhaupt nicht mehr möglich. Das gilt auch für unsere pädagogische Arbeit.
Wir kommen damit zu einer zentralen Aussage der sozialen Systemtheorie: In hochkomplexen Systemen sind gezielte Steuerung und Veränderung nur möglich, wenn Komplexität reduziert wird.
Solche Reduktion von Komplexität geschieht ständig. So reduzierte Karl Marx das ganze facettenreiche und vielschichtige System der Weltgeschichte auf eine Geschichte der Klassenkämpfe. Später haben Politiker über Jahrzehnte hin weltpolitische Komplexität reduziert und dadurch hantierbar gemacht, indem sie das vielfältige weltpolitische Szenarium auf den Ost-West-Gegensatz reduzierten und andere weltpolitische Ereignisse eher ignorierten.
Dass in komplexen Systemen Entscheidungen und Veränderungen nur möglich sind, wenn ihre Komplexität reduziert wird, ist auch im privaten Bereich eine durchgehende Erfahrung:
Wir könnten dies durchspielen an den Wahlen und Entscheidungen unseres Lebens. Theoretisch bietet das Leben unendlich viele Möglichkeiten. Zeit und Umstände aber reduzieren diese Komplexität. Oft müssen wir sie selbst reduzieren, um uns entscheiden und festlegen zu können aufgrund von bewussten und unbewussten Vorgaben. Und das tun wir ja auch ständig.
Klar aber ist: Solche gewollten und ungewollten, bewussten und unbewussten Reduktionen beeinflussen und verändern ihrerseits Wirklichkeit und setzen Fakten. Denn sie engen Handlungsmöglichkeiten ein, legen fest und rufen entsprechende Reaktionen hervor. Kybernetisch ausgedrückt: Es kommt zu zirkulären Prozessen. Und dies ist die Frage: Wie lässt sich komplexe Wirklichkeit in sozialen Systemen so reduzieren, dass sie nicht verfälscht wird oder wesentliche Teile ausgeblendet werden?
1.5 Die gestalthafte Reduktion von Komplexität
Wenn wir so abstrakt von sozialen Systemen sprechen, dann klingt das ganze Mit- und Gegeneinander, die ganzen vielschichtigen Beeinflussungen eher mechanisch und statisch. Sie sind aber sehr dynamisch. Könnten wir unsere Gruppen durchschauen, so sähen wir ein verwirrendes Szenarium mit einer großen Kulisse. Gestalt ist für mich nun das, was sich aus einem komplexen Szenarium herauspräzisiert, was sich in den Vordergrund schiebt. Und dies ist die gestaltpädagogische Reduktion von Komplexität: Wir versuchen nicht das Ganze zu erfassen, sondern reduzieren auf Gestalten. Gestalt aber ist nicht das Ganze, sondern das, was vom Ganzen in dieser Gruppe gerade jetzt wichtig ist, bevor anderes wichtig werden kann, woran wir jetzt nicht vorbeikommen, wenn wir weiterkommen wollen, was jetzt zu klären ist, bevor anderes geklärt werden kann, was jetzt verändert werden muss, damit andere Veränderungen möglich werden. Und es ist die Hohe Kunst der Gestaltpädagogen, genau diese Gestalt zu finden.